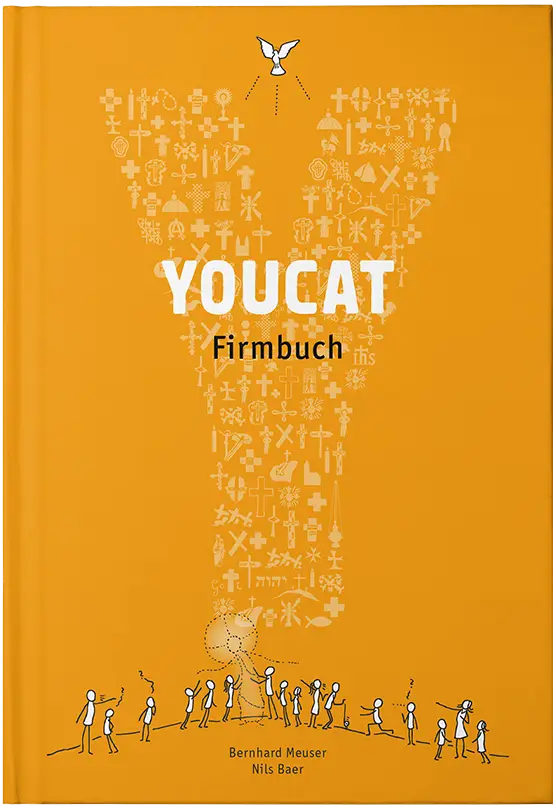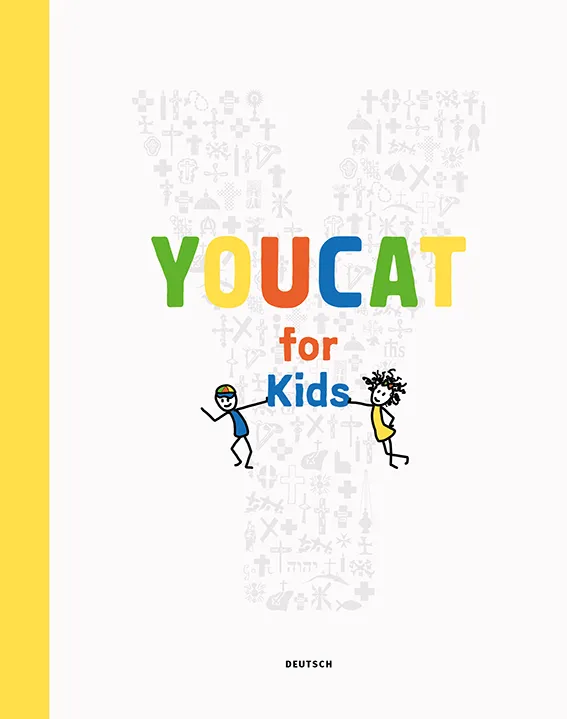Credopedia
Mutter Gottes
Wenn die Kirche die Mutter vergisst ...
Was ist das?
Maria, eine einfache Frau aus Galiläa, als „Mutter Gottes“ oder der „Gottesgebärerin“ (griechisch theotokos) zu bezeichnen, war und ist eine Provokation. Nach dem Jahr 200 taucht das Wort „Gottesgebärerin“ erstmal in einem Gebet auf, das noch heute gebräuchlich ist: „Unter deinen Schutz und Schirm, fliehen wir, heilige Gottesgebärerin ...“. Gregor von Nazianz schrieb um 382: „Wenn jemand die heilige Maria nicht als Gottesgebärerin anerkennt, ist er von Gott getrennt." In YOUCAT 82 heißt es: „Als die frühe Christenheit darum stritt, wer Jesus war, wurde der Titel Theotokos („Gottesgebärerin“) zum Erkennungszeichen der rechtgläubigen Interpretation der Heiligen Schrift: Maria hat nicht nur einen Menschen geboren, der dann nach seiner Geburt Gott ‘geworden’ wäre, sondern schon in ihrem Leib ist ihr Kind der wahre Sohn Gottes. Es geht bei dieser Frage nicht zuerst um Maria, sondern wieder um die Frage, ob Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist.“ 431 legte das Konzil von Ephesus diese Lehre allen Gläubigen als verbindlich vor.
Was sagt die Heilige Schrift?
An vielen Stellen im Neuen Testament wird Maria als Mutter Jesu angeführt, aber nur an einer Stelle wird ihr Muttersein mit einem göttlichen Eingriff verbunden, nämlich bei Mt 1,18: „Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.“ Durch die Geburt der Jungfrau (vgl. Jes 7,14) wollte Gott „dass Jesus Christus eine wahre menschliche Mutter, aber nur Gott selbst zum Vater hat, weil er einen Neuanfang machen wollte, der nicht irdischen Kräften, sondern allein ihm zu verdanken ist.“ (YOUCAT 80)
Die kleine YOUCAT-Katechese
Wenn die Kirche die Mutter vergisst ...
Der radikale Feminismus, der glücklicherweise bei vielen jungen Frauen nicht mehr ankommt, hatte ein Feindbild: die Mutter. Als Frau solltest du zu allem berufen sein – zum, Dax-Vorstand, zum Rugby-Profi, zur Trucker Pilotin - bloß nicht dazu, Mutter zu werden, Mutter zu sein. Man es muss bei Simone de Beauvoir (1908-1986), der „Mutter des Feminismus“, nachlesen, um immer noch nicht zu verstehen, wie man als Frau auf die absurde Idee kommen konnte, sich von der eigenen Natur zu befreien. Frauen, schrieb sie, müssten der „Sklaverei der Mutterschaft“ entfliehen; das Baby im Bauch der Mutter erschien ihr als „Parasit“. Zweimal trieb Simone den Beauvoir selbst ab; und in ihrem Pariser Salon richtete sie eine Abtreibungsklinik ein. Der Philosoph Robert Spaemann meinte einmal: „Emanzipation von unserer Natur kann nur heißen: Befreiung von uns selbst.“ Die unglücklichen geistigen Töchter dieser Frau machen sich jedes Jahr lautstark am Rand von Demonstrationen für das Lebensrecht von ungeborenen Kindern bemerkbar, wenn sie rufen: „Hätt’ Maria abgetrieben, wär’ Jesus uns erspart geblieben!“
Die größte symbiotische Einheit zwischen zwei Menschen ist dann gegeben, wenn ein Mensch zur Welt kommt, indem er im Leib eines anderen Menschen heranreift. Wohl in jeder Frau, die das einmal erlebt hat, ereignet sich eine tiefe Erfahrung: Obwohl von der ersten Minute der Befruchtung eigentlich klar ist, dass das Wesen, das sich in den Tiefen der Eingeweide versteckt, jemand anderes, ein anderer Mensch ist, - mein Fleisch und doch nicht mein Fleisch - ist, braucht eine Frau lange, um mit dem Herzen und mit dem Verstand dieses Geheimnis einzuholen. Und auch das Kind braucht eine gewisse Zeit, manchmal ein Leben lang, um zu verstehen, dass es nicht die Mama ist.
Jesus Christus hatte eine Mutter
Dass sich ein Gott genau in dieses Geheimnis hineinbegeben würde, gehört zum Unerfindlichen, das dem Christentum das Aroma der Wahrheit verleiht. Durch die Botschaft des Engels wächst in einem vielleicht 14- oder 15-jährigen galiläischen Dorfmädchen etwas, das sich wie eine Wucherung in ihrem Zellgewebe anfühlt – wie Fleisch von ihrem Fleisch. Und das doch nicht nur ein Anderer ist, sondern der ganz Andere: Gott.
Maria hat ganz die Einheit mit ihrem Kind, mit Jesus, empfunden, aber früh auch die Nicht-Einheit. Einfache Hirten machten sie prophetisch darauf aufmerksam, was ein Himmel voll Engel über ihr Kind „in Windeln gewickelt“ proklamiert hatte: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.“ (L2,11-12) Man könnte das einen Sprengsatz nennen für die naive Liebe einer Mutter zu „ihrem Baby“. Maria, heißt es, „behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.“ (Lk 2,19) Maria war sicherlich der Mensch, der Jesus am tiefsten verbunden war, aber gleichzeitig musste sie erfahren, dass dieses Kind nicht zu vereinnahmen war in die Strukturen einer irdischen Familie und die Routinen der Sippe. „Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. ... Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun.“ (LK 8,20)
Trotzdem steht sie, die Mutter - nachdem alle anderen geflohen waren - unter dem Kreuz, sie, und Johannes, der treue Freund. Die Pietá von Michelangelo hat für immer festgehalten, was die Frömmigkeit fühlte, als man den Leichnam ihres Sohnes in ihren Schoß legte, um in dieser zweiten Empfängnis noch einmal die Symbiose vom Anfang aufzurufen. Symbiose meint: nahtlose Einheit. Und das ist eben die ganze Botschaft, dass die Einheit zwischen Mutter und Kind nicht zu zerschlagen war – nicht einmal durch das tote Kind in den Armen der Mutter. Würden wir hinter der Pietá nicht das Morgenrot der Auferstehung sehen, es wäre das trostloseste Bild der Welt. Mutter und Kind wären für immer getrennt.
Die Kirche ist meine Mutter
Vom Kreuz herab stellt Jesus eine neue Familie zusammen. Zu Johannes sagt er: „Siehe, deine Mutter!“ Und zu Maria sagt er: „Frau, siehe dein Sohn!“ (Joh 19,26-27). „Diese Worte“, heißt es in YOUCAT 85, „die Jesus vom Kreuz herab zu Johannes sprach, sind von der Kirche immer als ein Anvertrauen der ganzen Kirche an Maria verstanden worden.“ Jesus selbst hat die symbiotische Einheit, die er mit Maria hatte, als er „Fleisch angenommen“ hatte „von der Jungfrau Maria“, auf die Kirche übertragen. (vgl. Nizänisches Glaubensbekenntnis)
Wie Maria ist auch die Kirche nicht Jesus. Aber wie Jesus ohne dieses unscheinbare Mädchen Maria nicht Mensch geworden wäre, so wird Jesus heute ohne die Kirche nicht leibhaft gegenwärtig in der Welt. Freilich, Gott kann auch jenseits der Kirche wirken, aber zunächst einmal hat er sie uns als Mutter gegeben. „Je mehr die Kirche nach dem Bild Marias lebt, desto mütterlicher wird sie, desto mehr kann man in ihr neu aus Gott geboren werden, eine Versöhnung vollziehen“, - Worte des evangelischen Priors von Taizé, Frère Roger Schutz. Hans Urs von Balthasar, der große Theologe des letzten Jahrhunderts, hat vom Marianischen Prinzip gesprochen und damit gemeint, dass die unerhörte Intensität der Beziehung zwischen Maria und Jesus einen Raum eröffnet, der so groß ist wie die ganze Kirche. Alles, was in der Kirche Leben und Liebe ist, alles, was dem Geist des Hörens und Empfangens, des liebenden Mitgehens mit Jesus bis unters Kreuz geschieht, passt zwischen Maria und Jesus, ereignet sich dort. „Drücke deines Sohnes Wunden, wie du selber sie empfunden, heil’ge Mutter, in mein Herz“, heißt es im berühmten Lied Stabat Mater. Das ist Christsein. Damit beginnt Jüngerschaft.
Wenn die Kirche ihre Mutter vergisst ...
Wenn die Kirche Maria vergisst (und damit die Liebe), wird sie hässlich und kalt. Und tatsächlich musste Hans Urs von Balthasar schon 1971 feststellen, was sich seither epidemisch vermehrt hat. Die Kirche „hat ihre mystischen Züge weitgehend eingebüßt, sie ist eine Kirche der permanenten Gespräche, Organisationen, Beiräte, Kongresse, Synoden, Kommissionen, Akademien, Parteien, Pressionsgruppen, Funktionen, Strukturen und Umstrukturierungen, soziologischen Experimente, Statistiken: mehr als je eine Männer-Kirche, es sei denn ein geschlechtsloses Gebilde, in dem die Frau ihren Platz soweit erobern wird, als sie selbst bereit ist ein solches zu werden.“ In ihrem Herzen ist die Kirche weiblich und mütterlich, und wir dürfen unsere „Mutter“ nicht ins Altenheim schicken, als sei sie Kirche von gestern und als müssten wir sie gerade neu erfinden. „Die Kirche“, bekannte ein anderer großer Theologe des letzten Jahrhunderts, Henri de Lubac, „ist meine Mutter, weil sie mir das Leben geschenkt hat. Sie ist es, weil sie mich beständig am Leben erhält und mich ... immer tiefer in dieses Leben hineinführt.“ ∎
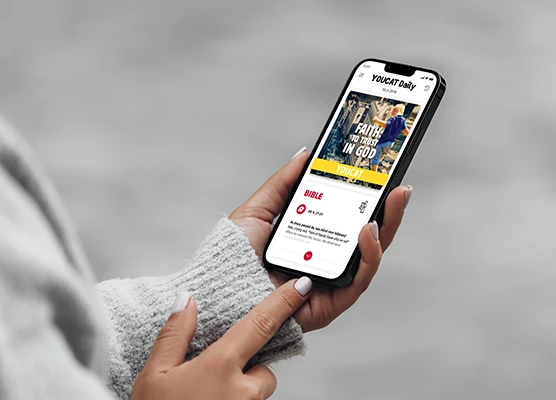
YOUCAT Digital
Entdecke hier unsere digitalen Produkte, die Dir helfen werden, im Glauben zu wachsen und selbst zum Missionar zu werden.